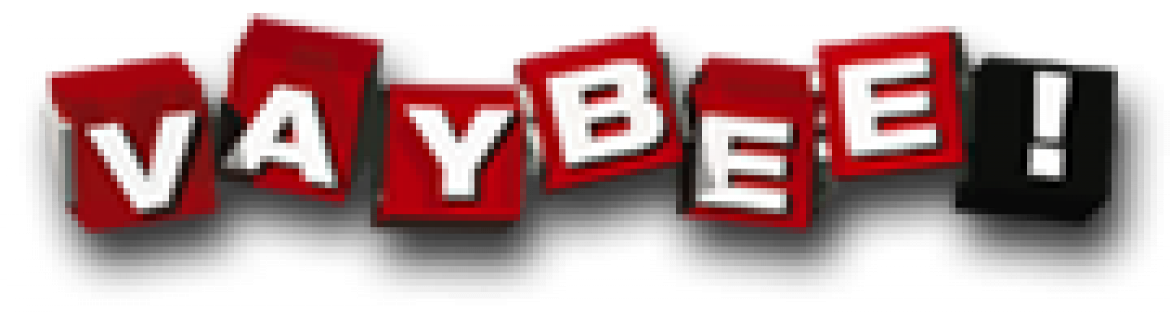Jüdisches Leben in der Türkei

Fast ein Jahr nach der blutigen Anschlagsserie in Istanbul (15. November 2003) ist die Neve Shalom-Synagoge im Altstadtteil Beyoglu wieder eröffnet worden. Die Neve Shalom ist das größte jüdische Gotteshaus Istanbuls und wurde am 25. März 1951 eingeweiht. 1986 töteten Mitglieder der palästinensischen Organisation „Islamischer Heiliger Krieg“ rund zwei Dutzend Gläubige in der Synagoge. Es war der erste Anschlag auf eine jüdische Einrichtung in der rund 500-jährigen friedvollen Geschichte der türkischen Juden.
Jüdische Einwanderung begann 1492 In der Türkei leben rund 35.000 Juden, 27.000 von ihnen in der Millionen-Metropole Istanbul. Die meisten sind Nachfahren der etwa 100.000 sephardischen Juden (von arabisch „Spanien“), die 1492 vor der spanischen Inquisition ins Osmanische Reich geflohen waren und dort eine "millet", eine autonome Glaubensgemeinschaft mit staatlich anerkannten eigenen Rechten und Riten, bilden konnten. Die Sepharden sind mit rund 96 Prozent die größte jüdische Gruppe in der Türkei.
Sultan Beyazit II. nahm die gebildeten Sepharden mit offenen Armen auf. "Sein Land lässt er verarmen, und mein Reich bereichert er", wunderte er sich über den spanischen König. Der Sultan hatte seinen Landsleuten befohlen, den Juden einen "herzlichen Empfang" zu bereiten – und davon war das Zusammenleben mit der moslemischen Mehrheit bis heute bestimmt. Gemäß dem islamischen Recht waren die Juden "dhimmis": Schutzbefohlene des Herrschers. Später flüchteten aschkenasische, Jiddisch sprechende Juden vor Pogromen in Osteuropa zu den Osmanen.
Das Reich Sultan Beyazits profitierte von den gebildeten Zuwanderern, die sich als Ärzte, Händler und Übersetzer niederließen. Noch heute zählen die Istanbuler Juden, "musevi", wie sie in der Türkei genannt werden, zur Oberschicht der Bosporus-Metropole.
Auch nach Gründung der Türkischen Republik 1923 waren Juden in der Türkei zumeist wohlgelitten. So nahm Ankara beispielsweise während der Hitler-Zeit zahlreiche jüdische Flüchtlinge aus Deutschland auf.
Wohlwollen und Offenheit gegenüber den Juden "Die Türkei war nie ein antisemitisches Land", schreibt Robert Schild, Autor der in Istanbul erscheinenden jüdischen Wochenzeitung Schalom. Alleine im Altstadtviertel Galata gibt es auch heute noch fünf Synagogen und drei jüdische Schulen, das Oberrabbinat hat hier ebenfalls seinen Sitz. Galata war im 19. Jahrhundert das Zentrum der Banken und der Geschäftswelt. Im Galata-Viertel lebten lange auch die meisten Juden und die christlichen Minderheiten.
Allerdings kennt die Geschichte der Juden in der Türkei auch Schattenseiten: So erließ Ankara im Zweiten Weltkrieg eine Sondersteuer für nicht-muslimische Minderheiten, die neben Griechen und Armeniern auch viele Juden hart traf. Viele, die nicht zahlen wollten oder konnten, wurden deportiert und in Arbeitslager gesteckt. Als es 1955 wegen des Zypern-Konflikts in Istanbul zu schweren Ausschreitungen gegen die griechische Minderheit kam, richteten sich die Angriffe der aufgebrachten Menge auch gegen Synagogen und jüdische Geschäfte. Viele Juden reagierten daraufhin mit einer Art Flucht in die innere Emigration oder wanderten aus.
Anerkennung des Staates Israel 1948 Einige Juden kehrten später zurück, andere gingen 1948 nach Israel, bauten Siedlungen nahe Tel Aviv und wurden zu einer wichtigen menschlichen Brücke zwischen Israel und der Türkei. Als erstes Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung erkannte die offiziell laizistische Türkei 1948 den neuen Staat Israel an.
Bis heute ist sie das einzige muslimische Land im Nahen Osten, das enge politische, wirtschaftliche und militärische Beziehungen zu Israel unterhält. 1996 schlossen beide Länder ein Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit; die Geheimdienste kooperieren eng.
Synagogen in der Türkei Insgesamt gibt es heute fast 40 Synagogen in der Türkei, fast die Hälfte davon in der Bosporus-Metropole Istanbul. Aber im Vergleich etwa zu den mitunter recht prunkvollen christlichen Kirchen sind die meisten Synagogen eher dezent in die städtische Architektur eingepasst. Auch mit religiösen Symbolen wie dem Davidstern wird im Alltag eher sparsam umgegangen. Der Grund für die Zurückhaltung ist ebenso klar wie einleuchtend: Bloß nicht provozieren, bloß nicht negativ auffallen.