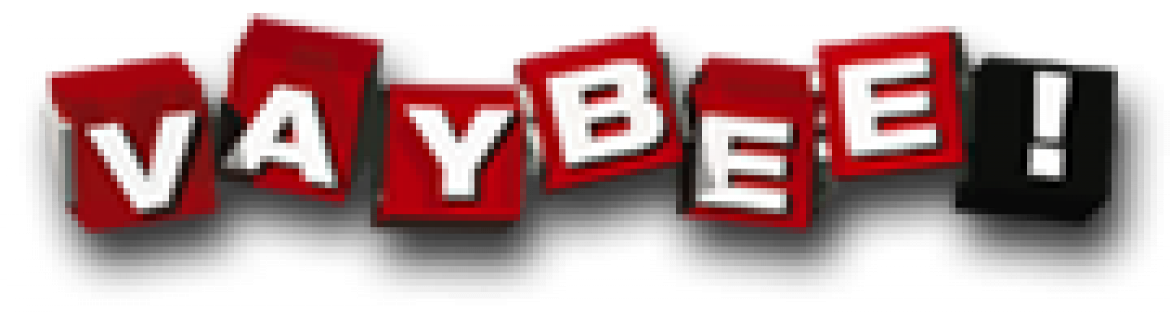Das deutsche Schulsystem

Die weiterführenden Schulen in Deutschland haben strapaziöse Tage hinter sich: Da galt es, Info-Abende an allen Grundschulen in der Umgebung zu beschicken. Am Tag der Offenen Tür wurde alles aufgeboten, was die Schule zu ihren Aktivposten zählt: mehr oder weniger redegewandte Direktoren, das versammelte Lehrerkollegium, Klavier oder Theater spielende Schüler. Hinterher versicherten sich dann die Lehrer in der Sprache von Werbeprofis gegenseitig, dass ihre «Präsentation doch ganz toll gelaufen» sei.
Zwischen März und Mai müssen sich in den deutschen Bundesländern die Eltern entscheiden, auf welche weiterführende Schule sie ihr Kind schicken wollen. Das Bedürfnis nach Information ist groß, und die Schulen betreiben angesichts sinkender Übergangszahlen «einen Riesenaufwand», um es zu befriedigen, weiß Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL) in Bonn. Über allem schwebt in diesem Jahr die Pisa-Studie, in der dem deutschen Schulsystem gerade ein Armutszeugnis ausgestellt wurde. Bildungsexperten verfolgen mit Spannung, ob bei den Eltern nun ein neuerlicher Ansturm auf das Gymnasium einsetzt.
Bislang hat es nicht den Anschein. In Nordrhein-Westfalen, das den übrigen Bundesländern vorauseilt, ist die Anmeldefrist bereits abgelaufen. Endgültige Zahlen liegen zwar noch nicht vor. «Man kann aber schon sagen, dass unter 50 Prozent der Schüler auf das Gymnasium wechseln werden», sagt zum Beispiel Klaus Kraemer vom Schulamt in Münster. Das ist zwar deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt, aber weniger als in früheren Zeiten: 1989/90 etwa wurde in der Universitätsstadt der Rekordwert von 54,4 Prozent erreicht. Ähnlich sind die Erfahrungen in Düsseldorf: «Der Anteil dürfte gegenüber den vergangenen Jahren in etwa konstant geblieben sein», so Willi Katemann vom Schulverwaltungsamt.
In Nordrhein-Westfalen wurde vor einigen Jahren der Elternwille zum ausschlaggebenden Kriterium bei der Schulwahl erklärt. Kritiker behaupten, dass sich die Zahl der falsch zugeordneten Schüler seitdem erhöht habe. Renate Hendricks, Vorsitzende des Bundeselternrates in St. Augustin (Nordrhein-Westfalen), ist anderer Auffassung: «Es hat sich gezeigt, dass Eltern bei ihrer Entscheidung in der Regel sorgsam vorgehen und sich an den Fähigkeiten ihres Kindes orientieren.» Darauf deuteten auch die in den vergangenen Jahren leicht rückläufigen Anmeldezahlen in den Gymnasien hin.
Eltern sollten, da sind sich alle Lager einig, keinen eigenen Ehrgeiz in die Schulwahl einfließen lassen. Inzwischen ist eine Elterngeneration herangewachsen, die selbst schon von der Bildungsexplosion der sechziger und siebziger Jahre profitiert hat. Da die Kinder nicht hinter den eigenen Stand zurückfallen sollen, liegt die Gefahr nahe, dass bestimmte Schulformen von Vornherein ausgeschlossen werden – mit fatalen Folgen: «Nichts ist für Kinder demotivierender als Misserfolg», weiß Hendricks.
Aber auch der umgekehrte Reflex ist noch immer anzutreffen: «Auf dem Land gibt es Eltern, die ihr Kind nicht auf ein Gymnasium lassen, auch wenn es das Zeug dazu hätte», weiß Lehrerpräsident Kraus. Eine falsche Weichenstellung in dieser Richtung ist dann aber nur noch schwer zu korrigieren: Zwar ist das deutsche Bildungssystem durchlässig – aber vor allem nach unten: Nach einer Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) in Dortmund kommen auf 100 Absteiger nur 5 Schüler, die in einen anspruchsvolleren Bildungsgang wechseln.
In Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen vertraut man darauf, dass die Lehrer das Leistungsvermögen der Schüler am besten einschätzen können. Hier geben die Noten den Ausschlag. Ein Kind, das etwa in Bayern auf das Gymnasium wechseln soll, muss einen Numerus clausus von 2,33 erreichen, in den Fächern Deutsch und Mathematik zusätzlich einen Schnitt von 2,0. Außerdem muss ein Wortgutachten die Eignung bestätigen. Werden die Kriterien verfehlt, sind Beratungsgespräche mit den Eltern und eventuell die Teilnahme am Probeunterricht im Gymnasium erforderlich.
Ob die Auswahl unter so harten Bedingungen und zu einem so frühen Zeitpunkt wirklich sein muss, wird im Zusammenhang mit der Pisa-Studie kontrovers diskutiert. Eltern tun möglicherweise gut daran, ihren Blick nicht starr auf die richtige Schulform zu richten. Es kommt immer auf die konkrete Schule an. «Auf jeden Fall sollten Eltern die zur Auswahl stehenden Schulen gemeinsam mit ihrem Kind besuchen und dort die Atmosphäre schnuppern», empfiehlt Renate Demmer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Frankfurt.
Auch eine generalstabsmäßig betriebene Auswahl entbindet Eltern aber nicht von ihrer wichtigsten Pflicht: Ohne Unterstützung von zu Hause wird es ihr Kind an jeder Schule schwer haben.