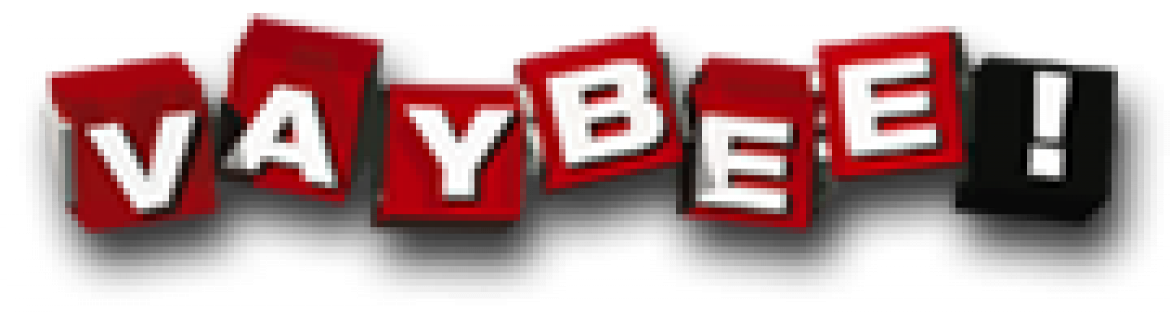Hamam

Schwitzen, schrubben, rubbeln, seifen und waschen, dass man meinen möchte, die Haut löse sich vom Körper. Nicht zuletzt durch den Besuch von Stefan Raabs Ex-Praktikant Elton weiß auch hierzulande jeder um die königlichen Freuden eines türkischen Dampfbads. Wer sich einmal der Prozedur eines solchen Bads unterzogen hat, wird eine Vorstellung davon haben, was es heißt, geistig und körperlich wiedergeboren zu werden. Denn mit ihren leicht brachial anmutenden Behandlungen haben die Tellaks, wie die Badeknechte in der Türkei genannt werden, schon so mancher müden Seele auf die Beine geholfen.
Gesellschaftlicher Treffpunkt für Männer und Frauen
In der islamischen Welt geht der Badespaß in einem Hamam auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Ein Besuch im Hamam hatte die Funktion, die Gläubigen für das Gebet zu reinigen, boten doch die öffentlichen Badehäuser die einzige Möglichkeit, sich mit warmem Wasser zu waschen.
Im Osmanischen Reich hat sich das Hamam zu einem sozialen und gesellschaftlichen Treffpunkt entwickelt, in dem türkische Kaufleute ihre Geschäfte besprachen oder Frauen sich mit Bekannten und Nachbarn zum Hamam-Klatsch trafen. Mütter, die für ihre Söhne nach einer geeigneten Partie suchten, hatten an diesem Ort die beste Gelegenheit dazu. Nicht selten dauerte ein Badespaß im Hamam bis in den späten Abend hinein – im türkischen Sprachgebrauch gibt es noch heute das Sprichwort "Kadinlar hamamina döndü", was ins Deutsche übersetzt so viel wie „Hier geht es zu wie einem Frauenhamam“ – also wie im Taubenschlag meint.
Strenge Geschlechtertrennung
Anders als in der Sauna wird in türkischen Badehäusern streng nach Geschlechtern getrennt. Wenn es sich nicht um ein größeres Doppel-Hamam mit seperatem Frauen- und Männertrakt handelt, baden Frauen meist vormittags an einzelnen Wochentagen. Der Freitagvormittag ist aber immer für Männer reserviert.
Zu pikierten oder gar entsetzten Blicken kann es kommen, wenn der Hamam-Besuch mit dem unbekleideten finnischen Saunaspaß verwechselt wird: Denn das Hamam ist keine Nacktzone. Der Anstandskodex im Islam schreibt das Tragen eines Pestemals, Baumwolltuchs, vor, das um die Hüften gewickelt wird.
Wie die antiken Thermen der Römer besteht auch ein türkisches Hamam aus drei Raumkomplexen: dem Camekan (Umkleide- und Erfrischungsraum), dem Hararet (Schwitzbad), in dessen Mitte sich ein Göbek Tas, ein erhitzter Marmorstein befindet, und dem Sogukluk (Kaltbad).
Ablauf im Hamam
Das traditionelle türkische Bad beginnt mit einer Schwitz-Session auf dem Schwitzstein, nachdem sich der Gast im Camekan umgezogen hat. Für die eigentliche Badeprozedur vertraut er sich dem Tellak an. Der seift den Körper im Schwitzraum (Hararet) von oben bis unten wie bei einem Kleinkind ein, und begräbt seinen Gast unter einer Schaumdecke. Dann wird er geschrubbt und gerubbelt, bis die Poren gründlich gereinigt sind. Nach reichlichen Heißwassergüssen geht es über zur Massage. Kein Körperteil wird ausgespart. Es wird durchgewalkt und geknetet, bis die Knochen knacken. Nach weiteren Wassergüssen gönnt sich der Gast im Sogukluk den wohl verdienten Abschluss.
Wellness-Trend löst Hamam-Renaissance aus
Im 17. Jahrhundert gab es in Istanbul 4536 private Hamams und 300 öffentliche. Heute existieren gerade einmal 70 Badehäuser. Da jeder türkische Haushalt über ein eigenes Bad verfügt, ist die Nachfrage nach einem Hamam rapide gesunken.
Ausgelöst durch den Wellness-Trend erlebt der Kult um das türkische Bad zurzeit eine kleine Renaissance: So haben einige internationale Hotels in Deutschland und in der Türkei diese Badekultur neu ins Programm aufgenommen. Auch werben immer mehr Wellness-Oasen in Deutschland mit dem türkischen Bad. In Berlin-Schönberg gibt es ein Sultan-Hamam, in dem ein dreistündiger Aufenthalt 14 Euro kostet. Für Existenzgründer, die sich auf dem Markt etablieren wollen, eine zündende Geschäftsidee.