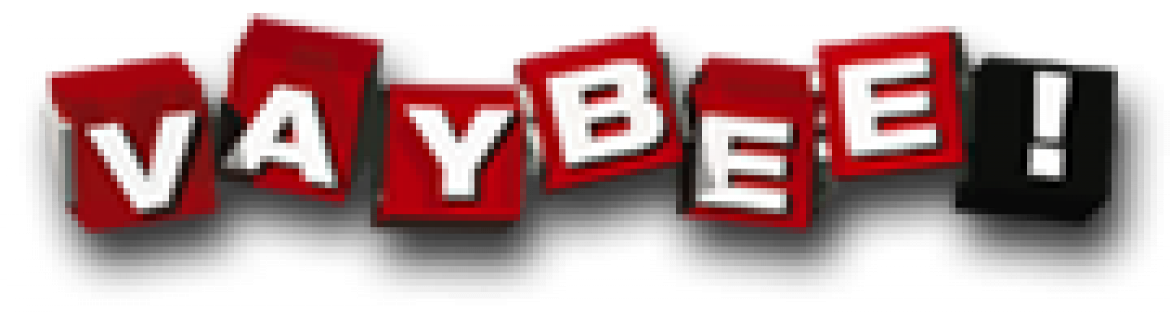Orhan Pamuk – ein Augenzeugenbericht

Orhan Pamuk, geboren am 7. Juni 1952 in Istanbul, gehört zu den wichtigsten Schriftstellern der Türkei. Er wurde Zeuge des großen Erdbebens, das vermutlich mehr als 40.000 Menschen das Leben gekostet hat. Einen Tag nach dem Beben reiste Pamuk nach Izmit, dem Zentrum der Katastrophe. Der Schriftsteller wollte mit eigenen Augen sehen, was die fünfundvierzig Sekunden, die das Erdbeben dauerte, für sein Land bedeuten. Hier seine Eindrücke.
Irgendwann zwischen Mitternacht und Morgen – wie ich später hörte, war es drei Uhr – bin ich durch den ersten Stoß des Erdbebens aufgewacht. Mein Bett, drei Meter entfernt von meinem Arbeitstisch im kühlen Erdgeschoß eines Steinhauses auf einer kleinen Felseninsel im Marmarameer, Perlmuttinsel heißt dieser Ort, schaukelte heftig hin und her wie ein armseliges Boot auf offener See, das plötzlich von harten Wellen getroffen wird. Aus der Tiefe der Erde, von einer Stelle, die direkt unter meinem Bett zu liegen schien, drang ein furchtbares Grollen empor. Ich stürzte, kaum bei Bewußtsein, instinktiv und ohne meine Brille aufzusetzen, in den Garten und rannte davon.
Dort draußen war die Nacht erfüllt von Tempo und Erregung, als geschehe viel auf einmal. Ein Teil meines Verstandes registrierte das in voller Stärke anhaltende Beben, nahm das Grollen aus dem Untergrund wahr. Ein anderer Teil stellte mich vor die Frage, warum alle zu dieser Stunde schossen (vermutlich gibt es in meinem Kopf ein Spezialgedächtnis, das sich aus den politischen Morden, Bombenanschlägen und die Nächte zerreißenden Schüssen der siebziger Jahre zusammensetzt und dessen Tür sich nur in Katastrophenzeiten öffnet). Später habe ich lange darüber nachgedacht, woher diese Gewehrschüsse kamen, konnte aber keine Erklärung finden.
Fünfundvierzig Sekunden dauerte der erste Stoß. Er mag vierzigtausend Leben gefordert haben. Noch bevor er endete, war ich vom Garten über die Seitentreppe in das Obergeschoß zu meiner Frau und meiner Tochter gelaufen. Beide waren wach und warteten ängstlich in der Dunkelheit. Der elektrische Strom war längst abgeschaltet. Wir gingen zusammen in den Garten. Das furchtbare Grollen hatte aufgehört, alles harrte in einem haarsträubenden Zustand des Wartens aus. Der Garten, die Bäume, die kleine Insel aus steilen Felsen war ruhig wie immer, doch mein heftig schlagendes Herz sagte mir, daß Schreckliches im Gange war. Wir flüsterten, vielleicht, um das Erdbeben nicht von neuem zu erzürnen. Schwächere Erdstöße kamen, und wir fürchteten uns weniger. Später, als meine siebenjährige Tochter in meinen Armen eingeschlafen war, lag ich mit ihr in der Hängematte im Garten und hörte aus den Vororten von Istanbul, aus der Gegend von Kartal die Sirenen der Ambulanzen.
In den folgenden Tagen habe ich vielen Menschen zugehört und von ihnen erfahren, was sie während der ersten fünfundvierzig todbringenden Sekunden gemacht haben. Die rund zwanzig Millionen, die den Schrecken des Stoßes fühlten und das Dröhnen aus der Tiefe hörten, schilderten während der ganzen ersten Woche nur diese Augenblicke, und sie erwähnten nicht die Toten. Man wollte das Erlebnis jener fünfundvierzig Sekunden mit anderen teilen. Der häufigste Satz lautete: »Wer das nicht erlebt hat, kann es nicht begreifen!«
Die Umarmung der Toten Ein Apotheker, der aus einem in sich zusammengestürzten Appartementhaus heil herauskam, erklärte zunächst, sie seien bei klarem Verstand und zwei andere, die aus diesem Gebäude entkommen waren, hätten das auch gesagt. Dann schilderte er, daß er in dem fünfstöckigen Haus für einen Moment nach oben schwebte und das deutlich wahrnahm und daß plötzlich der Bau über ihm zusammenkrachte. Manche erwachten, weil sie, rechts und links anstoßend, mit dem Gebäude hin und her geschüttelt wurden. Dann glaubten sie, daß sie sterben müßten, weil ihr Haus sich zur Seite neigte und umfiel. Als der Sturz vom Nebengebäude aufgefangen wurde, lief jeder sofort zu irgendeinem hin und umarmte ihn. So lagen auch die aus den Trümmern geborgenen Leichen beieinander.
Da mit dem ersten Stoß Töpfe, Fernseher, Schränke, Bücherregale, Nippes und alles, was an den Wänden hing, fielen, fanden Mütter, Söhne, Onkel und Großväter in den Wohnungen den nicht, den sie suchten. Sie wurden von der Wucht der niederstürzenden Gegenstände getroffen und stießen in der Finsternis auf unbekannte Wände. In den Staubwolken und in der Dunkelheit verloren die Menschen die Orientierung in ihren eigenen Wohnungen – und dennoch konnte mancher in jenen fünfundvierzig Sekunden einige Stockwerke hinunter über die Treppen ins Freie gelangen, bevor der Bau zusammenbrach.
Ich hörte Geschichten von Leuten, deren Großeltern in ihren Betten, ohne sich rühren zu können, den Tod erwarteten. Ich hörte Geschichten von Leuten, die glaubten daß sie im vierten Stock auf den Balkon liefen und sich auf einer Terrasse wiederfanden, die bis zum Straßenniveau abgesunken war. Andere hatten sich etwas aus dem Kühlschrank geholt und in den Mund gesteckt, kamen aber nicht zum Kauen. Vor Angst spuckten sie alles wieder aus. Viele Menschen hatten nicht schlafen können, bevor die ersten Stöße kamen. Und dann packte sie die Furcht vor der Gewalt, mit der das Haus erschüttert wurde – es war, wie einer sagte, als ob jemand das Haus in die Hand genommen und geschüttelt habe –, und schließlich stürzten sie und konnten sich nicht mehr erheben. Viele Menschen erzählten mir, sie seien, das Laken über den Kopf gezogen, im Bett geblieben – und viele Tote hat man in dieser Stellung gefunden –, und sie hätten die Dinge in aller Ruhe Allah überlassen.
Diese Geschichten habe ich aus den unglaublich schnell sprudelnden Geflüster- und Gerüchtequellen und von den Betroffenen selbst erfahren. Am nächsten Morgen schickten alle privaten Fernsehkanäle von Rang und Namen ihre Kameraleute mit Hubschraubern in die Erdbebengebiete und sendeten von dort ununterbrochen ihre Bilder. Auf meiner kleinen Insel und den großen, dicht bewohnten Inseln der Umgebung war es kaum zu Schäden gekommen, doch im Epizentrum auf dem gegenüberliegenden Uferstreifen – vierzig Kilometer Luftlinie von uns entfernt –, waren minderwertige Bauten eingestürzt und Menschen gestorben. Die Straßen und der Markt auf der Hauptinsel, zu der ich übersetzte, waren von Stille, Furcht und Schuldgefühlen überschattet. Dieses Erdbeben war deswegen so unglaubwürdig, auch so grauenhaft, weil so viele Menschen in unmittelbarer Nähe getötet worden waren. Und auch, weil es an all den Orten geschehen war, die ich aus meiner Kindheit kannte.
Von der Insel der Stille Am stärksten hatten die Erdstöße – mondsichelgleich – die im Osten des Marmarameeres liegende Bucht von Izmit erbeben lassen. Meine kleine Insel, die zu einer Inselgruppe gehört, befand sich dieser Mondsichel gegenüber, ungefähr dort, wo der Stern in die türkische Flagge eingezeichnet ist. Zwei Wochen nach meiner Geburt war ich auf eine dieser Inseln in die Sommerfrische mitgenommen worden, seit fünfundvierzig Jahren halte ich mich auf diesen Inseln und an verschiedenen Orten der Bucht auf, lebe ich hier. Die Stadt Yalova, deren Thermalbäder von Atatürk geschätzt wurden, und die auch wir aufgesucht hatten, weil sie sich ihres Hotels im westlichen Stil rühmte, lag in Trümmern.
Die Petrochemie-Anlagen, wo mein Vater einmal Direktor gewesen war, standen in Flammen. Kleine Ortschaften an verschiedenen Stellen der Mondsichel, Dörfer, die wir in meiner Kinderzeit zum Einkaufen besucht hatten, Uferstreifen, die man noch mit Appartementhäusern überziehen würde, Orte, an die ich mich in meinem zweiten Roman liebevoll und traurig erinnert habe und die sich in riesige Ferienanlagen verwandelten – sie alle waren dem Erdboden gleichgemacht. Am ersten Tag wehrte sich mein Verstand gegen die Katastrophe. Ich mochte die kleine Insel nicht verlassen, auf der das Leben in Stille weiterging.
Am zweiten Tag setzten wir mit einem Motorboot auf die Hauptinsel über und nahmen von dort aus ein Schiff nach Yalova. Niemand hatte uns gerufen, weder meinen Freund, den Autor eines Buches namens »Lob der Hölle«, noch mich, und wir wollten auch nicht darüber schreiben. Der Instinkt trieb uns, den Toten und Sterbenden nahe zu sein, von der glücklichen Insel fort und in das Entsetzen zu gehen. Auf dem Schiff sprachen die Menschen ruhig über das Erdbeben, lasen Zeitung. Neben mir saß ein pensionierter Postbeamter, Besitzer eines kleinen Ladens auf der Hauptinsel, wo er Milchprodukte aus Yalova verkaufte. Er fuhr heim nach Yalova, um festzustellen, was in seinem Haus umgestürzt war.
Yalova war eine Kleinstadt an einer grünen Küste gewesen und lag in einer Ebene, die Istanbul mit Obst und Gemüse versorgte. Während der letzten dreißig Jahre wurde das Ufer aufgeschüttet und betoniert, die Obstbäume wurden abgeholzt und auf dem Gelände entstanden Tausende von Appartementblocks, welche die kleinen Ortschaften der Umgebung aufzehrten und die Einwohnerzahl der Stadt auf fast eine halbe Million hochtrieben. Bei unserer Ankunft sahen wir, daß neunzig Prozent dieser Betonkästen zusammengestürzt oder so schwer beschädigt waren. Wir spürten, wie nichtig unsere heimliche Vorstellung war, helfen zu können, wie nichtig die Hoffnung, Trümmer zu heben: Nur wenige Menschen wurden nach drei Tagen lebend aus dem Schutt geborgen. Nur Deutsche, Franzosen, Japaner, Spezialisten auf diesem Gebiet, konnten zu ihnen vordringen. Die Katastrophe hatte mit solcher Wucht zugeschlagen, hatte das Schicksal der Stadt so tief greifend verändert, daß man an Hilfe nicht mehr glauben konnte – es sei denn, jemand hätte einen am Arm gepackt und zur Hilfe gerufen.
Fassungslos liefen die Menschen durch die Straßen, und wir liefen mit ihnen zwischen dem Schutt, den unter Trümmern eingeklemmten Autos, den umgestürzten Elekrizitätsmasten, traten auf Beton und Glas, auf Strom- und Telefondrähte. Auf Schulhöfen, in Parkanlagen und auf freien Grundstücken hatte man Zelte errichtet; Wir sahen Soldaten, die Straßen absperrten, und andere, die Trümmer hoben. Wir sahen Menschen, die verwirrt nach Adressen fragten, die Angehörige suchten, die sie verloren hatten, und Menschen, welche die für das Elend Verantwortlichen beschuldigten, und Menschen, die sich um einen Platz in einem Zelt stritten.
Autos mit Hilfsgütern fuhren durch die Straßen, Milchkartons und Konserven wurden verteilt, und man sah Lastwagen mit Soldaten oder mit Kränen und Baggerschaufeln. Wie es unter Kindern geschieht, die ins Spielen vertieft die wirkliche Welt vergessen, so redeten nun auch die Menschen in den Straßen ungeniert und direkt miteinander, erzählten ihre Geschichten. Die Katastrophe hatte jedem das Gefühl gegeben, daß die Welt ein anderer Ort ist. Die Regeln des Lebens schienen eingestürzt zu sein, um den Blick ins Innere freizugeben.
Lang betrachtete ich die Möbel in den Häusern, die sich zur Seite geneigt hatten und sich wie ein Spielzeughaus an das Nebengebäude anlehnten. Teppiche, die wie Fahnen an einem windstillen Tag hinabhingen, Schränke, Tische, Sessel und Divane, Kissen, Fernsehapparate, Blumentöpfe, Sonnenblenden, Staubsauger, Fahrräder, Hemden, Kleider in allen Farben, Bademäntel und Jacketts, Tüllvorhänge, die träge hin und her schwangen. Und überall das Innere der Häuser, von dem sich mein Blick nicht losreißen konnte. Das alles zeigt uns, wie schutzlos das menschliche Leben ist, und zeigte uns erneut, daß unser Dasein von Entscheidungen abhängt, die Menschen treffen, von denen wir wenig halten. Die miserablen Unternehmer die Schmiergelder aufsaugenden Stadtverwaltungen, die Bauleute, die sich an keine Regeln und Vorschriften halten, und die verlogenen Politiker- sie alle sind aus unserer Mitte hervorgegangen, und all unsere Klagen haben uns nicht vor ihren schlechten Praktiken bewahrt.
Wir gingen durch die Straßen und merkten, daß die Katastrophe unsere Psyche – und unsere Geschichte – unwiederbringlich verändert hatte. Ich betrat eine Gasse ging zum Garten eines noch nicht völlig zerstörten Hauses, in das sich niemals wieder ein Mensch hineinwagen wird, und stellte mir vor, wie die Frauen in den Küchen hinter den Fenstern zu diesem Garten, im dem nun Beton, Glas und Geschirr lag und eine Pinie stand, auf die sich ein Haus stützte, schauten und – früher einmal – hier ihre Hausarbeiten verrichteten. Uns allen vertraut: eine Frau, die wir hinter dem Küchenfenster gegenüber sahen ein Mann, der abends immer in derselben Ecke vor dem Fernseher sitzt, und ein Mädchen, das wir hinter den halbgeschlossenen Vorhängen sehen: Sie alle sind gar nicht mehr dort, weil das Küchenfenster gegenüber, die Sitzecke, der Vorhang, ja die Perspektive, an die wir uns über Jahre gewöhnt hatten, nicht mehr da sind. Und mit großer Wahrscheinlichkeit waren auch wir, die wir hier nach dort hinüber schauten, gar nicht mehr vorhanden.
»Meine Eltern sind dort«, sagte ein Sohn und zeigte irgendwo zwischen die schichtweise aufgehäuften Betonblöcke. »Wir waren nicht im Haus, wir sind erst nach dem Erdbeben hierher gerannt. Jetzt warten wir darauf, daß man sie herausholt.« Ein anderer sagte, er sei aus Kütahya gekommen, und er habe gesehen, daß das Gebäude, in dem seine Mutter lebte, ganz und gar zerfallen sei, und er wies mit der Hand auf die Trümmer und erklärte: »Wir warten auf unsere Tote, wir nehmen sie mit und gehen fort.«
Das Warten danach Sie gehen durch die Straßen, sitzen vor den Trümmerhaufen, stehen herum, weinen, schauen hilflos den langsam vorankommenden Rettungstrupps zu, und manche sind vielleicht eingeschlafen. Doch sie alle warteten, auf eine Nachricht von vermißten Bekannten, auf die Gewißheit, daß die Mutter unter den Trümmern liege (vielleicht aber war sie ja um zwei Uhr nachts aus dem Haus gegangen, obwohl das doch nicht ihrer Art entsprach). Sie warteten auf die Leichen des Onkels, des Bruders, des Sohnes, um diesen Ort mit ihnen zu verlassen, oder darauf, daß die Grabungsmannschaft, falls sie mit ihren Geräten dorthin gelangte, in dem Haufen von Staub und Beton Eigentum, Wertsachen fand, was man mitnehmen konnte. Sie warteten darauf, einen kleinen Lastwagen zu finden, auf den man die geretteten Sachen laden und woanders hinbringen konnte. Im Gegensatz zu den Nachrichten in Presse und im Fernsehen, die von Rettungswundern übertrieben berichten, war gegen Ende des dritten Tages trotz der Stimmen und Klopfgeräuschen, die Hoffnung gesunken, aus den Schutthaufen Überlebende zu bergen.
Es gibt zwei Arten von Ruinen von Trümmern. Die einen lassen noch die ursprüngliche Form erkennen, sind wie ein Karton umgekippt, zur Seite gefallen, oder einige Stockwerke sind kartenhausgleich zusammengeklappt. Hier ist es noch möglich, in den Leerräumen zwischen den Betonbrocken Lebende zu finden. Bei der zweiten Art ist nichts mehr von der ursprünglichen Form zu erkennen, weder die Stockwerke noch die Betonabschnitte. Nur ein Haufen aus Staub, Beton, Möbeln und Eisenstäben – hier noch jemanden lebend zu finden ist fast ausgeschlossen. Und es wird sehr lange dauern und der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gleichen, ehe man alle Toten gefunden hat.
Wenn ein Kran langsam ein Stück Beton anhebt, schauen alle mit müden, schlaflosen Augen zu. Und wenn ein Toter gefunden wird, klagen sie: »Man hat gestern den ganzen Tag das Weinen gehört, aber niemand ist gekommen.« Bevor der Körper in einem Hohlraum zu sehen ist, der mit Schaufeln, Wagenhebern, Eisenstücken oder Spitzhacken geöffnet wird, kommen die Gegenstände der Toten ans Licht, ein gerahmtes Hochzeitsfoto, ein Kästchen mit einer Halskette und Kleider, verbreitet sich ein durchdringender Leichengeruch. Und wenn ein Loch in den Beton getrieben wurde und ein Experte oder ein freiwilliger Helfer mit einer Handleuchte hineinkriecht und zu suchen beginnt, dann kommt Bewegung in die vor den Trümmern wartende Menge, jeder hat etwas zu sagen, gibt es Gedrängel und Geschrei. Die durch das Loch eingestiegenen Helden, die in den meisten Fällen in den jeweiligen Gebäuden gar nicht wohnten, aber zufällig dort menschliche Laute gehört hatten, rufen nach den Helfern mit den Spitzhacken. Doch vor lauter Lärm ist kaum etwas zu verstehen. Und die Arbeiten ziehen sich hin und man begreift, daß es Wochen dauern wird, bis diese Ruinen geräumt sind und Leiche um Leiche geborgen ist
Quelle: medico.de Irene Iren