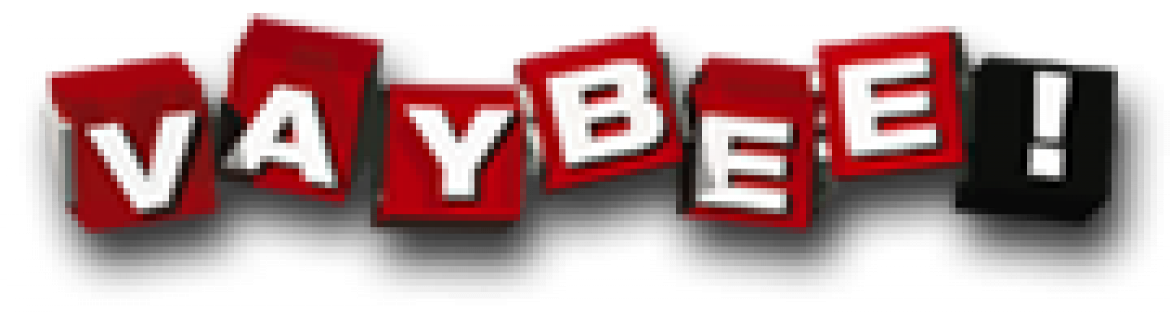Istanbul – die Stadt selbst ist der Star

Die Türkei, ein Land mit einem Bein im Mittelalter, mit dem anderen mitten in der Moderne – und in der Metropole Istanbul trifft alles zusammen. Dreißig Künstler haben in der Ausstellung "Call me ISTANBUL ist mein Name" die türkische Hauptstadt in Bilder, Geräusche und Multimediaprojektionen umgesetzt. Eine vibrierende Schau zwischen High-tech und orientalischer Folklore.
Istanbul. Eine Stadt aus Lärm und Chaos, Geräuschen und Gerüchen, aus modernen Gegensätzen und vertrauten Ritualen. Sarkis, der Altmeister unter den türkischen Künstlern mit Ruf auch hier bei uns im Westen, hat in einem abgedunkelten Kabinett der Schau eine Klangreportage installiert von Istikal Caddesi, der Istanbuler Hauptgeschäftsstraße. Zu sehen gibt es nichts, es ist der Versuch, dieser Stadt, dem Moloch Istanbul, akustisch-assoziativ auf die Spur kommen.
Der Amerikaner Roger Conover, der Kurator der Schau, war mehrfach dort am Bosporus und hat sich von dem urbanen Konglomerat faszinieren lassen:
Istanbul ist einer der stärksten städtischen und architektonischen Schauplätze, die es heute weltweit gibt. Es repräsentiert alles, was die Globalisierung des 21. Jahrhunderts ausmacht. Eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht ein Kunstwerk im Übergang ist, eine Stadt, die unstabil ist, die fortwährend improvisiert und sich ständig ändert, die sich immer wieder neu erschafft. Eine Stadt also voll dynamischer Kraft und Vitalität, und das passt in das neue Jahrhundert, das sich gerade entwickelt.
Eine Autobahn eigentlich mehr als eine Stadt, und die Künstler natürlich auf der Überholspur. Wie aber stellt man so was aus?
Als Architektur zunächst einmal. Und also präsentiert sich diese Schau als ein Basar der tausend Möglichkeiten. Als Leitplanke fährt eine 60 Meter lange Wand mit fensterartigen Durchblicken schräg in die Ausstellungshallen hinein. Allenthalben Monitore, Multimediaprojektionen, Geräusche, Bilder.
Und so tappen wir durch verwinkelte Kabinette, Gassen und Korridore, betreten dann wieder Schauplätze mit Skulpturen, gehen eine Rampe hinauf zu einem Aussichtspunkt, stolpern Treppen hinab, zwischen hängenden Teppichen und Tüchern – ein labyrinthisches, lärmendes Gewirr und flüchtiges Gewimmel.
Die Türkei, ein schwankendes, zerrissenes Land, mit einem Bein im Mittelalter, mit dem anderen mitten in der Moderne, und in der Metropole Istanbul trifft alles zusammen. Da demonstriert ein türkischer Barbier in einem Video die aussterbende Technik einer traditionellen Rasur, daneben erzählt ein Transvestit von seinen Erfahrungen.
Man mag sich all die Wandlungen, die Spannungen zwischen islamischer Tradition und enthemmter westlicher Moderne ausmalen, und auch das kreative Potenzial, das die Künstler aus der Stadt beziehen.
Can Altay etwa hat die allgegenwärtigen Müllsammler beobachtet, die Tag und Nacht die Straßen sauber halten und auf ihre Art zum Funktionieren der urbanen Gesellschaft beitragen. Die Schwestern Anny und Sibel Öztürk haben eine jener typischen, ohne Baugenehmigung errichteten Wohnbaracken gebastelt, wie sie in Istanbul zu Abertausenden vom Zentrum in das Umland wuchern. Hale Tenger spielt mit Phallussymbolen auf den Macht- und Machokult der türkischen Gesellschaft an und ihre Kollegin Sermin Sherif zeigt 45 teils albern-absurde Varianten, sich mit einem Kopftuch zu verhüllen. Und auch das Klischee wird ordentlich bedient.
Auf einer Bühne lässt die Istanbuler Gruppe "Yoghurt Technologies" eine echte Bauchtänzerin auftreten, deren Bewegungen sie dann mit dem Computer in ein virtuelles Kunstwesen auf der Leinwand verwandelt.
Andere Künstler behandeln Migrationsprobleme in den Grenzgebieten zu Bulgarien und Griechenland oder zelebrieren mit rohem Fleisch und blutigen Innereien auf dem Körper eine türkische Art des Wiener Aktionismus. Eine vibrierende Schau zwischen High-tech und orientalischer Folklore. Roger Conover:
Die Schau ist der Versuch, alle Grenzen zu verwischen, die in einem normalen Ausstellungskontext Dinge trennen würden wie Architektur und Kunst, städtisches Leben und Mode, Design und Malerei. Hier haben wir stattdessen eine eigene Stadt erschaffen, eine Totalcollage aus Tönen und Ansichten, Bildern, Erfahrungen, Bewegungen und Aktivitäten. All das haben wir zusammengepackt in das Projekt eines urbanen Zustands. Wohlgemerkt, das ist nicht die Stadt selbst. Es geht nicht darum, Istanbul in einen Kasten zu sperren, sondern einen Raum zu öffnen, wo wir uns dieser lebendigen Stadt annähern können. Deshalb gibt es hier auch keine Künstlerstars. Istanbul, die Stadt selbst ist der Star.
In der Tat sind die 30 Künstler hier eher als Kultur- und Sozialarbeiter tätig, die den Blick und das Bewusstsein schärfen für diese, ihre Stadt.
Nein, natürlich bekommt die Ausstellung die Stadt nicht in den Griff, aber sie vermittelt zumindest eine Ahnung vom Unfassbaren dieser urbanen Metastase. Istanbul ist in der Gegenwart längst angekommen, auch in der Kunst, und es hat, glaubt Roger Conover, noch eine beispielhafte Zukunft:
Vielleicht repräsentiert Istanbul so etwas wie New York zu seinen besten Zeiten vor ein paar Jahrzehnten, also ein Beispiel für das, was eine Stadt sein kann, in all ihrer schlampigen Lebendigkeit und unhygienischen Schönheit.
Service: Die Ausstellung "Call me ISTANBUL ist mein Name" findet im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie aus Anlass der 17. Europäischen Kulturtage Karlsruhe zum Thema "Istanbul" vom 18. April bis 8. August 2004 statt.